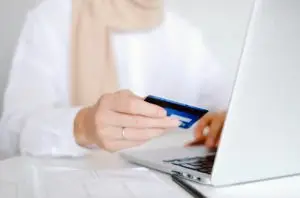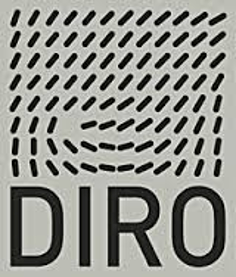Die Rechtsprechung gesteht den Versicherungsgesellschaften eine „angemessene“ Prüfungsfrist vor möglichen Zahlungen zu. Eine genaue Angabe des Prüfungszeitraums ist von den Umständen des Einzelfalles abhängig. Die derzeitige Rechtsprechung kann dabei wie folgt zusammengefasst werden:
Die Prüfungsfrist beginnt nicht am Unfalltag, sondern frühestens mit der Schilderung des Unfallherganges und der Bezifferung der Höhe der einzelnen Ersatzansprüche.
Kommt es bei der Bezifferung einzelner Schadenspositionen zu Verzögerungen, beispielsweise bei der Bezifferung der Höhe des Schmerzensgeldes, weil Arztberichte noch nicht vorliegen, kommt es auf den Zeitpunkt der Bezifferung des ersten Anspruchs an.
Manche Gerichte lassen die Prüfungsfrist erst beginnen mit der Übersendung der jeweiligen Dokumente (Gutachten oder Rechnungen), die die Höhe der einzelnen Schadenspositionen belegen. Üblicher Weise werden diese sofort mitübersandt.
Wechselt man von der Abrechnung auf Gutachtenbasis (fiktive Abrechnung) auf die Abrechnung durch Vorlage von Rechnungen (konkrete Abrechnung), beginnt nach einem Urteil des OLG Koblenz eine neue Frist.
Verzögerungen durch Einsichtnahme des Versicherers in die Ermittlungsakte werden von den meisten Gerichten nicht anerkannt, erst recht nicht, wenn man dem Versicherer eine von der Polizei gefaxte Unfallanzeige weiterleitet, die üblicher Weise schnell besorgt werden kann.
Früher war eine Überprüfungszeit von etwa 4-6 Wochen gängig; heute geht die Tendenz der Gerichte dahin, den Prüfungszeitraum auf 2-3 Wochen, maximal 4 Wochen in Standardfällen zu verkürzen.
Nach Ablauf der Prüfungsfrist besteht Verzug des Versicherers und es können Verzugszinsen geltend gemacht werden, wenn den Versicherer ein Verschulden an der verzögerten Zahlung trifft. Fordert der Versicherer zu Recht weitere Belege an, kommt er nicht in Verzug.
Bei rechtlich komplizierteren Sachverhalten kann sich die Prüfungsfrist auch auf 6 Wochen verlängern. Bei einem Inlandsunfall mit einem Ausländer hat das Landgericht Saarbrücken ausnahmsweise auch eine Prüfungsfrist von 2 Monaten eingeräumt.
Erst nach Ablauf der Prüfungsfrist besteht Anlass zur Klage. Ob die Einreichung einer Klage im Ergebnis aber gegenüber der außergerichtlichen Regulierung nicht zu weiteren Verzögerungen führt, kann nicht pauschal beantwortet werden. Durch außergerichtliche Zahlungen vermindert sich in jedem Fall das Prozessrisiko und bei vorschneller Einreichung einer Klage muss der Kläger bei einem sofortigen Anerkenntnis des Versicherers die angefallenen Gerichtskosten sowie die Anwaltskosten des eigenen Anwalts und des gegnerischen Anwalts selbst tragen.