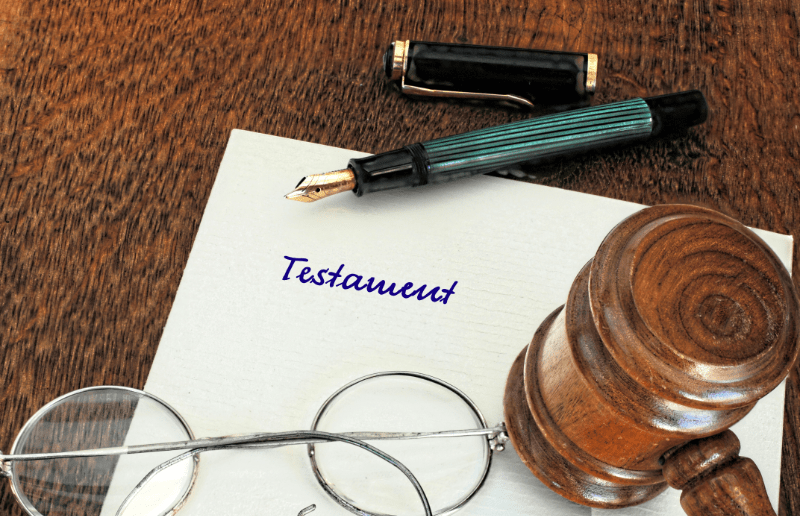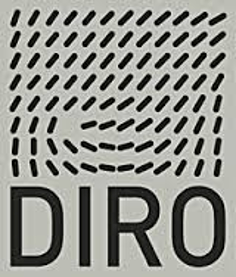Mit der Zunahme der Dauer der Lebenserwartung der Menschen geht auch eine zunehmende Pflegebedürftigkeit älterer Menschen einher, die zu einer Vielzahl von rechtlichen und finanziellen Problemen führt.
Oftmals wird die Pflege noch zu Hause von Angehörigen erledigt, um eine Einweisung ins Pflegeheim zu vermeiden. Diese nahen Angehörigen müssen dann mitunter beruflich zurückstecken oder ihre Freizeit opfern, um diese Pflege gewährleisten zu können. Dies kommt dem zu Pflegenden zugute, der sich auf eine vertraute Person verlassen kann und nicht fremde Leute, z. B. von professionellen Pflegeeinrichtungen, ins Haus lassen muss. Durch diese Art der familiären Pflege wird auch ein etwaiges Vermögen geschont, das später den Erblassern zugute kommt.
In diesen Fällen entsteht aber dann nach dem Tod oft das Problem, dass der pflegende Angehörige einen finanziellen Ausgleich für diese zum Teil entbehrungsreichen und jahrelangen Pflegeleistungen haben will. Das Gesetz sieht hierfür in zwei Vorschriften einen Ausgleichsanspruch vor, der jedoch oftmals nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt und seine Tücken hat. So sieht § 2057 a BGB einen Ausgleichsanspruch zwischen den Kindern des Erblassers vor, wenn diese gesetzliche Erben werden. Es ist aber im Gesetz nicht definiert, in welcher Höhe dieser finanzielle Ausgleich stattzufinden hat. Vielmehr ist nach dem Wortlaut des Gesetzes die Ausgleichung so zu bemessen, wie es mit Rücksicht auf die Dauer und den Umfang der Leistungen und dem Wert des Nachlasses der Billigkeit entspricht. Dies kann zur Folge haben, dass bei geringerem Vermögen eben gerade nicht alle Pflegeleistungen Berücksichtigung finden, sondern nur teilweise. Sofern Kinder als Miterben untereinander zerstritten sind, entsteht dann oft auch Streit über die Dauer der Pflegeleistungen. Es fehlen oft entsprechende Nachweise für Dauer und Umfang der Pflegeleistungen.
Auch für den Fall, dass ein Abkömmling des Erblassers nicht zum Erbe berufen ist, dafür aber einen Pflichtteilsanspruch hat (z. B. im Falle einer Enterbung durch Testament) sieht § 2317 BGB einen entsprechenden Ausgleichsanspruch für den pflegenden Angehörigen vor, wobei dieselben Probleme wie in der zuvor geschilderten Konstellation entstehen können.
Anzuraten ist daher, entweder noch zu Lebzeiten des zu pflegenden Erblassers unter den Erben eine Verständigung herbeizuführen oder zumindest eine Art Tagebuch über die Pflegeleistungen zu führen, in dem möglichst detailliert Umfang, Inhalt und Dauer der Pflegeleistungen dokumentiert wird. Dies dient zum einen als Gedächtnisstütze, zum anderen später als Nachweis im Falle einer streitigen Auseinandersetzung.
Diese tagebuchartige Aufstellung ist am besten noch durch Zeugen zu bestätigen, im allerbesten Fall bestätigt die zu pflegende Person die abgeleisteten Pflegeleistungen. Es kann auch eine Vereinbarung zwischen dem Erblasser und dem pflegenden Angehörigen über die Vergütung zu Lebzeiten oder im Erbfall getroffen werden. Im Falle einer Demenz des zu pflegenden Erblassers scheidet eine solche Bestätigung durch diesen mangels Rechtswirksamkeit jedoch aus, sodass dann möglichst andere Familienangehörige oder Beteiligte (z. B. Hausarzt, zusätzlicher Pflegedienst etc.) Bestätigungen ausstellen können.
Soweit die zu pflegende Person Anspruch auf Zahlungen aus der Pflegekasse hat, muss natürlich Berücksichtigung finden, ob diese Gelder sogleich dem pflegenden Angehörigen zufließen oder im Vermögen der Pflegeperson verbleiben. Im ersteren Falle muss überprüft werden, ob die Zahlungen der Pflegekasse einen angemessenen Ausgleich für Dauer und Umfang der Pflegeleistungen darstellen. In diesem Fall sieht § 2057a BGB vor, dass dann eine gesonderte Ausgleichsleistung nach dem Tod des Erblassers nicht mehr stattfindet.
Eine gesetzliche Lücke besteht für den Fall, dass die Pflege gerade nicht durch ein Kind des Erblassers durchgeführt wird, sondern z. B. durch das Schwiegerkind oder einen entfernteren Verwandten. Hier sieht das Gesetz keinen Ausgleichsanspruch vor. Deswegen ist es gerade in solchen Fällen besonders wichtig, schon zu Lebzeiten des zu pflegenden Erblassers eine entsprechende Regelung mit diesem herbeizuführen, um einen lebzeitigen Ausgleich zu erhalten. Der Abschluss entsprechender Pflegevereinbarungen wird dringend empfohlen.