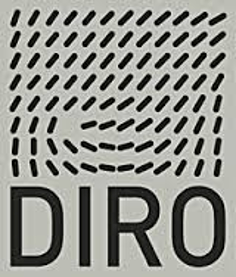Wenn Eheleute sich trennen, stellt sich immer wieder die Frage, wer in der Ehewohnung verbleiben darf. Bei der Beurteilung dieser Frage ist zunächst zu klären, ob es sich um eine Mietwohnung oder um ein Eigenheim handelt.
Steht die Wohnung im Eigentum eines der beiden Eheleute, ist dies besonders zu berücksichtigen. Soweit keine gemeinsamen Kinder vorhanden sind, die bei dem Ehegatten verbleiben sollen, der nicht Eigentümer der Wohnung ist, führt dies dazu, dass regelmäßig der Eigentümer der Wohnung bleiben darf und der andere Ehegatte weichen muss. Etwas anderes könnte allenfalls gelten, wenn der Ehegatte ohne Eigentum an der Wohnung besonders schutzbedürftig ist. Daran lässt sich z.B. denken, wenn dieser Ehegatte schwer erkrankt ist oder er aus anderen Gründen nicht so schnell eine Ersatzwohnung finden kann wie der Ehegatte, dem die Wohnung gehört. Selbst wenn jedoch der Ehegatte mit Eigentum dem anderen den Vortritt lässt, muss dies nicht auf Dauer sein. Wenn sich die Umstände ändern, die zur Überlassung der Wohnung geführt haben, kann in der Regel eine Räumung verlangt werden. Es empfiehlt sich jedoch, dass der weichende Ehegatte zum Zeitpunkt der Überlassung der Wohnung an den anderen Ehegatten klar macht, dass er sich vorbehält, das Nutzungsrecht später zurückzuverlangen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nach dem Gesetz davon ausgegangen wird, dass der weichende Ehegatte dem anderen die Wohnung auf Dauer überlassen will.
Wenn der besitzende Ehegatte dem anderen Ehegatten, der ohne Eigentum ist, die Wohnung überlässt, sollte auch zugleich die Frage geregelt werden, welche Miete bzw. Nutzungsentschädigung der andere Ehegatte zu zahlen hat. Oftmals kommt eine Verrechnung mit dem zu zahlenden Unterhalt in Betracht. Ebenso verstärkt sich die Stellung des Ehegatten mit Eigentum nach Ausspruch der Scheidung. Dann sieht das Gesetz vor, dass grundsätzlich der Eigentümer auch in seiner Wohnung wohnen darf, auch wenn z.B. der andere Ehegatte weniger verdient und daher mehr Schwierigkeiten hat, eine Ersatzwohnung zu finden.
Eine besondere Konstellation stellt es dar, wenn die Ehewohnung so groß ist, dass beide Eheleute in dieser getrennt nebeneinander leben können. Dann wird für die Übergangszeit der Trennung auch von den Gerichten erwartet, dass die Eheleute unter einem Dach wohnen bleiben. Insbesondere in den Fällen, in denen ein ganzes Haus die Ehewohnung darstellt, mehrere Etagen vorhanden sind, in denen jeweils ein Bad und eine Küche integriert sind, kommt eine solche Aufteilung des Eigenheims in Betracht.
Ist die Ehewohnung eine angemietete Wohnung, kommen zwar grundsätzlich die oben genannten Kriterien zur Anwendung, welcher Ehegatte schutzbedürftiger ist. Dies ist grundsätzlich derjenige Ehegatte, bei dem etwaige gemeinsame Kinder verbleiben. Denn grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ein Ehegatte mit Kindern mir Schwierigkeiten hat, eine Ersatzwohnung zu finden. Des Weiteren soll den Kindern das gewohnte Umfeld erhalten bleiben, damit diese nicht die Schule wechseln müssen etc. Beachtet werden muss, dass der Eigentümer der Mietwohnung eingebunden werden muss. Wenn also beide Ehegatten den Mietvertrag unterschrieben haben, muss der Eigentümer über den Auszug eines der Ehegatten informiert werden, damit der Mietvertrag einem der Ehegatten allein fortgesetzt werden kann. Können sich die Ehegatten nicht einigen, kann ein Gericht auch die Wohnung einem der Ehegatten zuweisen und dadurch den Mietvertrag zulasten des Vermieters einseitig dahingehend ändern, dass nur noch der verbleibende Ehegatte Mietvertragspartner des Vermieters ist.