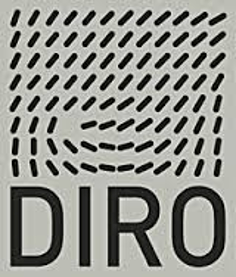Der Bundesgerichtshof hat hinsichtlich der Abrechnung eines Fahrzeugschadens 3 unterschiedliche Fallgruppen entwickelt. Unter dem „Fahrzeugschaden“ werden dabei die Reparaturkosten zzgl. Minderwert verstanden. Der „Wiederbeschaffungswert“ ist der Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall, der „Restwert“ der Wert des Fahrzeugs nach dem Unfall, der durch die Veräußerung des geschädigten Fahrzeuges noch erzielt werden kann. Der „Wiederbeschaffungsaufwand“ ist die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Restwert.
Die 1. Fallgruppe betrifft die Fälle, in denen der Fahrzeugschaden über dem Wiederbeschaffungswert liegt, die 2. Fallgruppe, wenn der Fahrzeugschaden unter dem Wiederbeschaffungswert und über dem Wiederbeschaffungsaufwand liegt und die 3. Fallgruppe, wenn der Fahrzeugschaden unter dem Wiederbeschaffungsaufwand liegt.
In der 1. Fallgruppe liegt der Fahrzeugschaden über dem Wiederbeschaffungswert, d.h. eine Reparatur ist eigentlich unwirtschaftlich. Soweit der Geschädigte sein Fahrzeug nicht repariert, erhält er von der gegnerischen Haftpflichtversicherung nur den Wiederbeschaffungsaufwand, d. h. den Wiederbeschaffungswert abzgl. des Restwertes. Soweit eine teilweise Reparatur erfolgt, erhält er bei „Abrechnung auf Gutachtenbasis“ ebenfalls nur den Wiederbeschaffungsaufwand. Soweit er jedoch Reparaturrechnungen vorgelegt, erhält er die Reparaturkosten bis zum Wiederbeschaffungswert ersetzt. Soweit eine vollständige und fachgerechte Reparatur erfolgt, werden die Reparaturkosten i.d.R. bis zu 130 % des Wiederbeschaffungswerts erstattet. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Geschädigte das Fahrzeug nicht innerhalb von 6 Monaten weiterveräußert. Veräußert der Geschädigte innerhalb von 6 Monaten sein Fahrzeug erhält er nur den Wiederbeschaffungsaufwand.
In der 2. Fallgruppe liegt der Fahrzeugschaden unter dem Wiederbeschaffungswert und über dem Wiederbeschaffungsaufwand. Soweit der Geschädigte das Fahrzeug nicht repariert, das Fahrzeug aber verkehrssicher ist, erhält er die Reparaturkosten bis zum Wiederbeschaffungswert. Soweit er sein Fahrzeug innerhalb von 6 Monaten nach dem Unfall veräußert, erhält er jedoch auch hier nur den Wiederbeschaffungsaufwand. Wenn der Geschädigte das Fahrzeug nur teilweise repariert und das Fahrzeug verkehrssicher ist, erhält er die Reparaturkosten bis zum Wiederbeschaffungswert. Soweit der Geschädigte das Fahrzeug innerhalb von 6 Monaten veräußert, erhält er bei fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis nur den Wiederbeschaffungsaufwand, bei konkreter Abrechnung die Reparaturkosten bzw. den Wert der Reparatur bis zum Wiederbeschaffungswert. Repariert der Geschädigte vollständig und fachgerecht, erhält er von der gegnerischen Versicherung die Reparaturkosten bis zum Wiederbeschaffungswert. Eine Weiternutzung ist nicht notwendig.
In der 3. Fallgruppe liegt der Fahrzeugschaden unter dem Wiederbeschaffungsaufwand. In diesen Fällen erhält der Geschädigte die Reparaturkosten bis zum Wiederbeschaffungsaufwand.