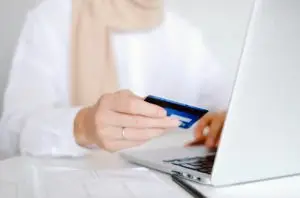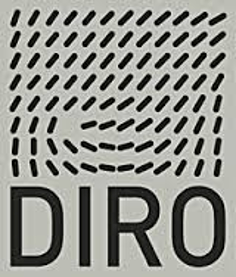Verkehrsunfälle, bei denen Kinder verletzt werden, gehören zu den schlimmsten Ereignissen im Straßenverkehr, unabhängig davon, ob der Fahrer des Fahrzeugs oder das Kind den Unfall verursacht hat.
Bei Verkehrsunfällen mit Kindern ergibt sich aus § 7 Straßenverkehrsgesetz, dass der Halter des Fahrzeuges grundsätzlich haftet und seine Haftung nur widerlegen kann, wenn er beweist, dass der Unfall auf höherer Gewalt beruht.
Höhere Gewalt liegt nicht schon vor, wenn der Unfall auch unter höchster Sorgfalt nicht zu vermeiden war. Der Unfall muss außergewöhnlich und „betriebsfremd“ sein, d. h. dass man den Unfall nicht mehr dem versicherten Betriebsrisiko des Fahrzeuges zurechnen kann.
Wenn ein Kind bei Dunkelheit zwischen geparkten Autos auf die Straße läuft und von einem PKW erfasst wird, ist dies keine höhere Gewalt, so dass grundsätzlich die Haftung des Halters besteht, obwohl ihn keinerlei Schuldvorwurf trifft.
Andererseits haften auch Kinder im Straßenverkehr innerhalb gewisser Grenzen. Kinder bis zum Alter von 7 Jahren haften grundsätzlich nicht. Es ist jedoch an eine Haftung aufsichtspflichtiger Personen (beispielsweise der Eltern des Kindes) zu denken, wenn diese die Aufsichtspflicht verletzt haben. Dabei müssen Kinder altersentsprechend beaufsichtigt werden. Je älter die Kinder werden, umso mehr reduziert sich die Aufsichtspflicht, weil Kinder nicht ständig zu beaufsichtigen sind.
Kinder zwischen dem 7. und dem 10. Lebensjahr haften aufgrund der Sondervorschrift des § 828 II BGB ebenfalls nicht bei Unfällen im Straßenverkehr, es sei denn, dass sie vorsätzlich gehandelt haben. Wenn Kinder vorsätzlich Steine von einer Autobahnbrücke werfen und dies zu einem Unfall führt, haften sie im Alter zwischen 7 und 10 Jahren für den Schaden. Bei Unfällen mit Radfahrern oder Fußgängern gelten die allgemeinen Regeln, d. h. eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn das Kind nicht über die erforderliche Einsichtsfähigkeit verfügt.
Im Alter zwischen 11 und 18 Jahren besteht grundsätzlich eine Haftung des Kindes, es sei denn, dass die Kinder die erforderliche Einsicht für ihre Verantwortlichkeit nicht haben. Das Landgericht Hamburg hatte in dem Fall eines 11 jährigen Kindes, das unachtsam auf die Straße lief und von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde, dem Kind einen Haftungsanteil von 70% und dem Halter einen Haftungsanteil von 30% auferlegt. Die Einsichtsfähigkeit des Kindes hatte das Landgericht in diesem Einzelfall bejaht.
Absolut wichtig ist, dass Kinder über die private Haftpflichtversicherung der Eltern mitversichert sind, weil ansonsten in Sekundenbruchteilen wirtschaftliche Katastrophen entstehen können.