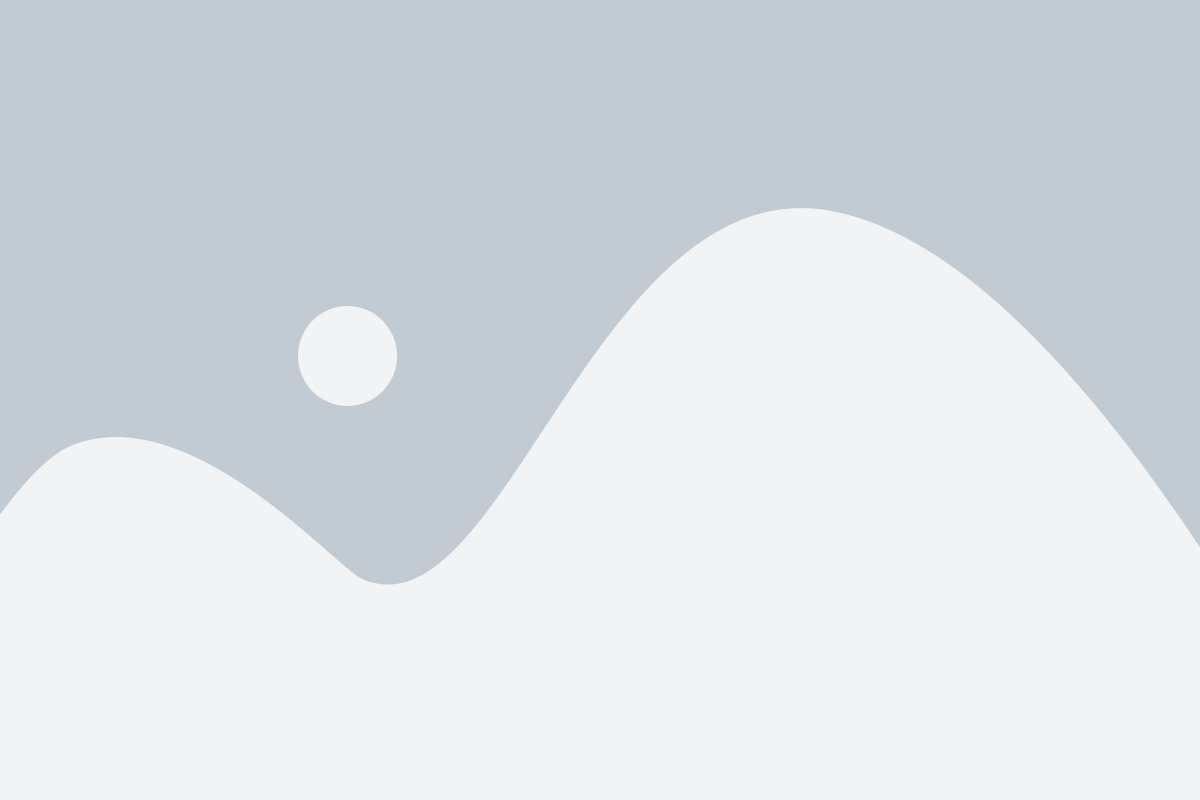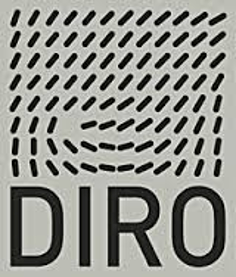Zu Gunsten schwerbehinderter Menschen gibt es zahlreiche Schutzvorschriften.
Dies beginnt bereits im Grundgesetz. Nach Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Das gleiche Benachteiligungsverbot steht in § 81 Abs. 2 SGB IX.
Mittlerweile hat der Gesetzgeber dieses Benachteiligungsverbot im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) konkretisiert.
Danach dürfen schwerbehinderte Menschen vor allem bei ihrer Einstellung, bei ihrem beruflichen Aufstieg, bei der Durchführung des Arbeitsverhältnisses sowie im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht benachteiligt werden.
Sehr praxisrelevant sind § 85 SGB IX, wonach die Kündigung eines Schwerbehinderten der Zustimmung des Integrationsamtes bedarf, und § 125 SGB IX, der dem schwerbehinderten Arbeitnehmer einen Zusatzurlaub von fünf Tagen sichert.
Schwerbehinderte im Sinne des Gesetzes sind Menschen, bei denen ein Grad der Behinderung von mindestens 50 % vorliegt. Menschen, die diesen Grad der Behinderung nicht erreichen, können einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden. Ein entsprechender Antrag auf Gleichstellung muss bei der Arbeitsagentur gestellt werden.
Die Gleichstellung setzt voraus, dass der behinderte Mensch mindestens einen Grad der Behinderung von 30 % hat und sich gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland aufhält. Er muss weiter infolge der Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können.
Um eine Anerkennung als Schwerbehinderter zu erreichen, muss zunächst ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Im Saarland ist die zuständige Behörde das Landesamt für Soziales (Hochstraße 67, 66115 Saarbrücken).
Die Diskriminierung eines Schwerbehinderten liegt vor, wenn der schwerbehinderte Arbeitnehmer wegen seiner Behinderung schlechter behandelt oder gestellt wird als andere, ihm vergleichbare Stellenbewerber oder Arbeitnehmer. Eine Diskriminierung liegt dann nicht vor, wenn es für eine solche Schlechterstellung einen triftigen, sachlichen Grund gibt. Liegt dieser sachliche Grund nicht vor, so ist die Benachteiligung des Schwerbehinderten verboten.
Die fünf Tage Zusatzurlaub stehen nur dem schwerbehinderten Arbeitnehmer zu und nicht dem diesem gleichgestellten Arbeitnehmer. Die Gleichstellung bezieht sich nur auf den Schutz des Behinderten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichgestellt sind, genießen einen besonderen Kündigungsschutz. § 85 SBG IX sieht für den Arbeitgeber, der einem schwerbehinderten Arbeitnehmer kündigen will, ein besonderes Verfahren vor. Bevor der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines schwerbehinderten Menschen kündigen kann, muss er dazu die Zustimmung des Integrationsamtes einholen.
Dieser besondere Kündigungsschutz setzt die Anerkennung als Schwerbehinderter im Zeitpunkt der Kündigung nicht voraus. Entscheidend ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer objektiv schwerbehindert ist und er den Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderter spätestens drei Wochen vor Zugang der Kündigung bereits gestellt hatte.
Damit wird der Situation Rechnung getragen, dass zwischen einem Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderter und der Feststellung durch das zuständige Amt Wochen und Monate vergehen können.
Ein Sonderfall liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber im Zeitpunkt der Kündigung die Schwerbehinderung des gekündigten Arbeitnehmers nicht kennt. Der gesetzliche Sonderkündigungsschutz nach § 85 SGB IX hängt jedoch davon nicht ab. Um das Risiko des Arbeitgebers in dem Fall zu begrenzen, hat die Rechtsprechung in zahlreichen Entscheidungen festgestellt, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer seinen Kündigungsschutz verliert, wenn er nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung dem Arbeitgeber mitteilt, dass er schwerbehindert ist.
Damit soll sichergestellt sein, dass der Arbeitgeber rechtzeitig von der Schwerbehinderung erfährt, um dann ggf. die Zustimmung des Integrationsamtes einzuholen und danach erneut zu kündigen.
Nach § 71 Abs. 1 SGB IX sind private und öffentliche Arbeitgeber, die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, verpflichtet, mindestens 5 % ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Erfüllt ein Arbeitgeber diese Pflicht nicht, ist er verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 105,00 bis 290,00 € pro Monat zu zahlen.
Wenn sich ein Arbeitnehmer auf eine freie Stelle bewirbt, so ist er nicht verpflichtet, seine Schwerbehinderung zu offenbaren. Eine entsprechende Frage des Arbeitgebers darf der Schwerbehinderte verneinen.
Dies gilt jedoch nicht, wenn nach Beginn des Arbeitsverhältnisses sechs Monate vergangen sind. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Arbeitgeber berechtigt, nach der Schwerbehinderung zu fragen, damit er weiß, ob er Zusatzurlaub gewähren muss bzw. ob er seiner gesetzlichen Pflicht zur Beschäftigung Schwerbehinderter ausreichend nachkommt.
Der Arbeitgeber muss dann auch wissen, ob er für den Fall einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes braucht.
Bei Fragen zu Ihren Rechten als Schwerbehinderter können Sie sich gerne an unsere Kanzlei oder das Landesamt für Soziales wenden.