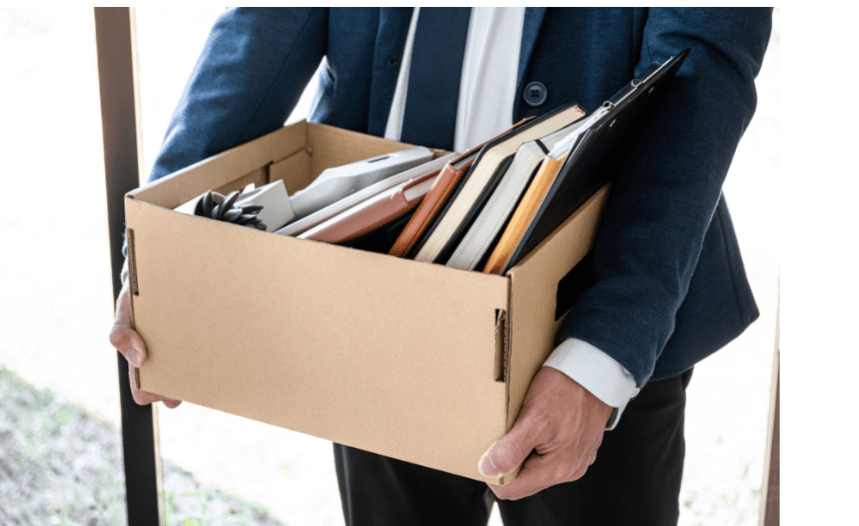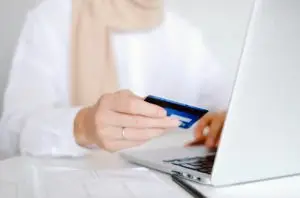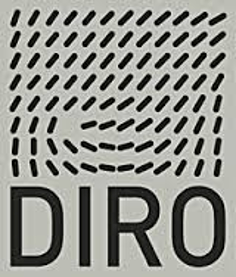Dazu gibt es zwischenzeitlich Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Es ist dabei zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag vereinbarten Mehrurlaub zu unterscheiden.
Nach § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz verfällt der gesetzliche Mindesturlaub grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres. Nur bei vorliegend dringender betrieblicher oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründe ist eine Übertragung des Urlaubs bis zum 31.03. des auf das Urlaubsjahr folgende Kalenderjahr nach § 7 III Satz 2 Bundesurlaubsgesetz zulässig.
Bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 20.01.2009 entsprach es der Rechtsprechung in Deutschland, dass, wenn ein Arbeitnehmer seinen Urlaub bis zum Ende des Jahres oder ausnahmsweise bis zum Ende des Übertragungszeitraums, d.h. bis zum 31.03. des nächsten Jahres, wegen Krankheit nicht nehmen konnte, der Urlaub verfiel.
Der Europäische Gerichtshof hat in der sogenannten „Schulz-Hoff-Entscheidung“ entschieden, dass diese Rechtsprechung und entsprechende Regelungen in Tarif- oder Arbeitsverträgen europarechtswidrig und damit unwirksam sind, wenn sie den Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs auch für den Fall vorsehen, dass der Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit innerhalb des Urlaubsjahres und/oder des Übertragungszeitraumes nicht genommen werden konnte.
Diese Entscheidung betraf jedoch nur den gesetzlichen Mindesturlaub und nicht den Mehrurlaub, der dem Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrages oder eines Tarifvertrages zustand.
Diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2009 hatte die Konsequenz, dass bei einer lang andauernden Arbeitsunfähigkeit gesetzliche Urlaubsansprüche über Jahre unbegrenzt angesammelt werden konnten. Damit war deshalb ein hohes finanzielles Risiko für den Arbeitgeber verbunden, der diese Ansprüche im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hätte abgelten müssen.
Um dieses Risiko zu entschärfen, hat das Bundesarbeitsgericht deshalb in seiner Entscheidung vom 07.08.2012 entschieden, dass der gesetzliche Mindesturlaub, der aufgrund einer lang andauernden Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb des Urlaubsjahres oder des gesetzlichen Übertragungszeitraumes genommen werden kann, spätestens 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres verfällt. Dabei hat sich das Bundesarbeitsgericht auf Artikel 7 der „Europäischen Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung“ gestützt, die den Verfall von gesetzlichen Urlaubsansprüchen 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres vorsieht.
Dies bedeutet beispielsweise, dass Urlaub aus dem Jahr 2013, der aufgrund von Arbeitsunfähigkeit nicht genommen werden kann, spätestens am 31.03.2015 verfällt.
Dies hat insbesondere dann Bedeutung, wenn das Arbeitsverhältnis vor diesem Zeitpunkt endet. In dem Fall muss der Arbeitgeber den Urlaub, der bis zum Beendigungszeitpunkt noch nicht verfallen ist und der vom Arbeitnehmer wegen Krankheit nicht genommen werden konnte , abgelten.