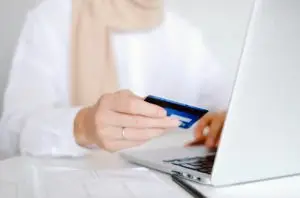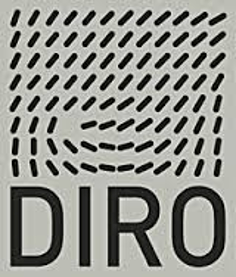Verkehrsunfälle, die vom Unfallgegner alleine verschuldet sind, werden üblicherweise zunächst gegenüber der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners geltend gemacht. Wenn sich die Regulierung durch die gegnerische Haftpflichtversicherung – aus welchen Gründen auch immer – verzögert und längere Zeit in Anspruch nimmt, empfiehlt es sich – soweit vorhanden – die eigene Vollkaskoversicherung in Anspruch zu nehmen. Bei Inanspruchnahme der Vollkaskoversicherung wird jedoch nicht der volle Schaden durch die Vollkaskoversicherung erstattet. Die vereinbarte Selbstbeteiligung wird von der Vollkaskoversicherung abgezogen. Außerdem entsteht durch die Inanspruchnahme der Vollkaskoversicherung in der Regel ein Höherstufungsschaden, d.h. die Prämienzahlungen erhöhen sich. Nicht erstattet werden von der Vollkaskoversicherung auch die Wertminderung, angefallene Gutachterkosten, Abschleppkosten, Mietwagenkosten bzw. Nutzungsausfall und die Kostenpauschale.
Dennoch empfiehlt es sich, die Vollkaskoversicherung mit anwaltlicher Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil die von der Vollkaskoversicherung nicht übernommenen Schadenspositionen als restlicher Schaden gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden können. Dabei ist das sogenannte Quotenvorrecht zu beachten, das dazu führt, dass Sie unter dem Strich im Ergebnis prozentual mehr erhalten können, als Ihnen nach Ihrer Mithaftungsquote zustünde. Das klingt etwas seltsam, ist aber so.
Wenn der Verkehrsunfall vollständig vom Unfallgegner zu tragen ist, muss die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners auch die von der Vollkaskoversicherung nicht übernommenen Positionen vollständig übernehmen, einschließlich Höherstufungsschaden und Selbstbeteiligung, so dass Ihnen unter dem Strich kein Schaden verbleibt.
Aber auch dann, wenn der Verkehrsunfall nicht ausschließlich durch den Unfallgegner verschuldet wurde und Sie selbst ein Mitverschulden an dem Unfall tragen, kann die Inanspruchnahme der eigenen Vollkaskoversicherung bei reinen Sachschäden sehr interessant sein. Auch in diesen Fallkonstellationen zahlt die gegnerische Haftpflichtversicherung überwiegend die von der Vollkaskoversicherung nicht übernommen Schäden.
Das Interessante dabei ist, dass die gegnerische Haftpflichtversicherung diese Schäden nicht lediglich in Höhe Ihrer Mithaftungsquote zahlt. Die Selbstbeteiligung, angefallene Sachverständigenkosten, die Wertminderung sowie die Abschleppkosten (bevorrechtigte kongruente Schäden) können zu 100 % gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden, selbst wenn Sie den Verkehrsunfall z.B. zu 50 % mitzuverantworten haben. Die weiteren Nebenpositionen Ihres Schadens, wie z.B. Mietwagenkosten / Nutzungsausfall, Kostenpauschale und Höherstufungsschaden aus der Inanspruchnahme der Vollkaskoversicherung (nicht bevorrechtigte inkongruente Schäden) werden nach der Haftungsquote reguliert.
Dieses sog. Quotenvorrecht führt im Ergebnis dazu, dass Sie bei einem Verkehrsunfall, den sie bspw. zu 50 % mit verursacht haben, ihren Schaden durchaus zu über 90 % erstattet erhalten. Diese Vorteile können durch entsprechende Programme schnell berechnet werden. Schadenersatzprozesse, die sich oft über mehrere Instanzen und Jahre hinziehen, können bei einer solchen kombinierten Abrechnung mit der Vollkaskoversicherung und der gegnerischen Haftpflichtversicherung oft vermieden werden. Auch wirtschaftlich ist die dargestellte Vorgehensweise aufgrund des Liquiditätsvorteils und nicht erforderlicher Zwischenfinanzierungen betreffend Werkstattkosten usw. oft vernünftiger, als über Jahre zu prozessieren.